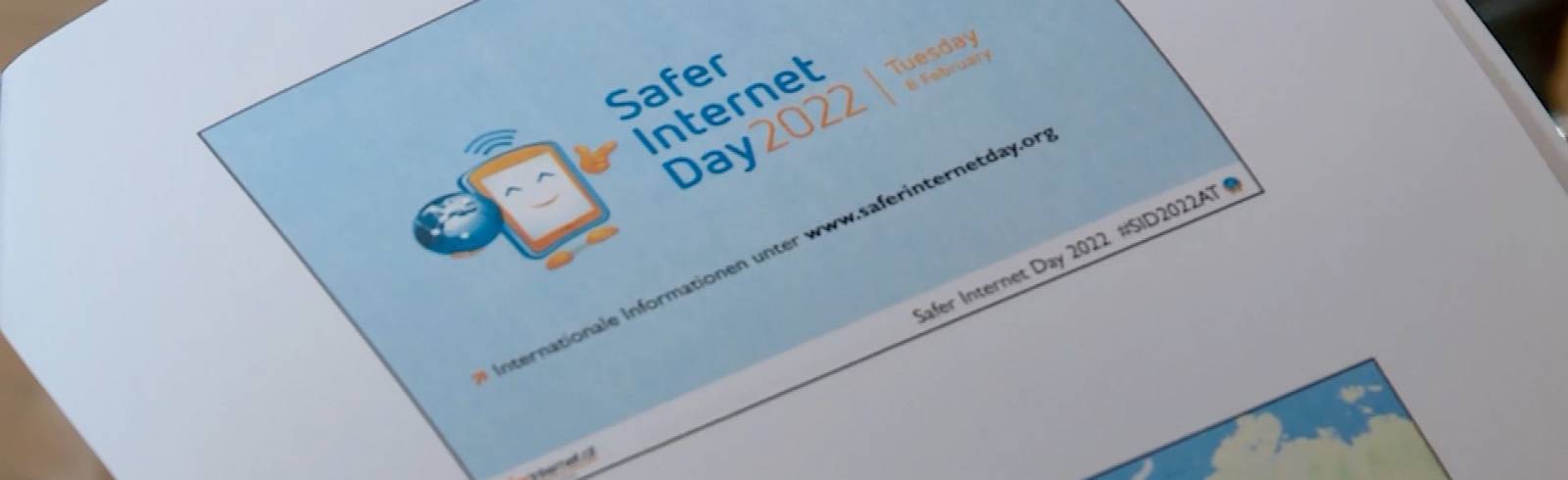

Cybermobbing hat in der Pandemie zugenommen
Einer zum 19. Safer Internet Day am 8. Februar erstellten Studie zufolge hat Cybermobbing - das absichtliche und über einen längeren Zeitraum anhaltende Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen, Belästigen oder Ausgrenzen von Personen über digitale Medien - zugenommen und passiert am häufigsten im schulischen Umfeld. 17 Prozent der Jugendlichen sind bereits Opfer von Cybermobbing geworden, 42 Prozent haben es bei anderen beobachtet und jeder Zehnte hat aktiv selbst mitgemacht.
Für eine vom Institut für Jugendkulturforschung und Kulturvermittlung im Auftrag von Saferinternet.at und ISPA - Internet Service Providers Austria - durchgeführte Studie sind 400 Jugendliche im Alter von elf bis 17 Jahren befragt worden. Zusätzlich wurden die Ergebnisse mit Praxiserfahrungen aus Saferinternet.at-Workshops ergänzt. Demnach haben 48 Prozent der befragten Jugendlichen bereits Beschimpfungen und Beleidigungen im Netz am eigenen Leib erfahren. 46 Prozent waren von Ghosting - dem abrupten unangekündigten Kontaktabbruch - betroffen und 41 Prozent gaben an, dass Lügen und Gerüchte über sie verbreitet wurden. Weitere häufig genannte Erfahrungen waren Identitätsdiebstahl durch Fake-Profile und der Erhalt unangenehmer Nachrichten mit jeweils 37 Prozent, gefolgt von Einschüchterungsversuchen mit 33 Prozent.
Vermehrtes Homeschooling hat zu neuen Arten von Cybermobbing geführt. So wurde 30 Prozent der Befragten die Teilnahme am Online-Unterricht absichtlich erschwert, 23 Prozent wurden von schulischen Informationen ausgeschlossen und 22 Prozent während des Online-Unterrichts verspottet. "Leider ist die Präventionsarbeit gerade in dieser Zeit, die für viele Jugendliche eine besondere Herausforderung darstellt, zu kurz gekommen", so bedauerte Barbara Buchegger, pädagogische Leiterin von Saferinternet.at, am Montag bei der Präsentation der Studie im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien. Zugleich erhalten Betroffene in der Schule die meiste Unterstützung. "Es wäre absolut keine Option, die Nutzung von Social Media als absolutes Übel darzulegen", konstatierte Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP). Stattdessen sollten Bezugspersonen wie Eltern und Lehrende besser geschult werden.
Laut 44 Prozent der Befragten geschieht Cybermobbing nicht zwangsläufig mit böser Absicht. Vielmehr werden die Grenze zwischen Spaß und Ernst nicht erkannt. Weitere Gründe sind der Wunsch nach Machtausübung (43 Prozent), die Demonstration von Gruppenzugehörigkeit (36 Prozent), rassistische Motive (33 Prozent). 31 Prozent können weder mit dem eigenen Zorn noch der eigenen Langeweile umgehen. "Da könnte die Prävention bei den Eltern und in der Schule einsetzen", meinte Buchegger.
Durch die häufigere Nutzung von Online-Plattformen während der Pandemie stieg auch die Zahl der Betroffenen. Am häufigsten wurden in diesem Zusammenhang Social-Media-Plattformen wie Instagram (56 Prozent), TikTok (42 Prozent), Facebook (36 Prozent) und Snapchat (32 Prozent) genannt. Erst danach folgte WhatsApp mit 30 Prozent, obwohl der Großteil der Befragten diesen Messenger-Dienst nutzt.
Mit der Studie werde der "Mythos der anonymen Täterschaft widerlegt", so ISPA-Präsident Harald Kapper. 43 Prozent der Betroffenen ahnen zumindest, wer für das Cyber-Mobbing verantwortlich ist. 30 Prozent geben an, es genau zu wissen.
Als wichtigste Ansprechpartner für Betroffene gelten Freundinnen und Freunde (78 Prozent), gefolgt von Eltern mit 71 Prozent und Lehrenden (64 Prozent). Allerdings sind für 48 Prozent Eltern nicht hilfreich, 33 Prozent gaben an, Fälle würde von Lehrenden nicht ernst genommen.
Täter auf besagten Plattformen zu blockieren, gilt laut 70 Prozent der Jugendlichen als nützliche Strategie. Diese zu melden, ist laut 59 Prozent hilfreich. Allerdings wurden diese Meldungen laut 45 Prozent nicht wie erwartet bearbeitet.
Da die Schule als Ort des Geschehens, aber auch als potenzieller Ort der Hilfe und Prävention gilt, sollen laut der Initiative Saferinternet.at Maßnahmen und Angebote im Rahmen von Fortbildungen für Lehrende ausgebaut werden. Im Weiteren soll auf den Ausbau der Schulsozialarbeit, Schulpsychologie und präventive Maßnahmen gesetzt werden. (APA)

